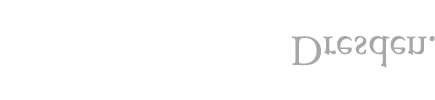Drehbuchautorin Laila Stieler im Gespräch
Viele Jahre hat Laila Stieler an verschiedenen Drehbuchfassungen zu „Gundermann“ geschrieben, dem aktuellen Film von Andreas Dresen über den Lausitzer Liedermacher. Mit dem Regisseur verbindet sie eine jahrelange Arbeitsbeziehung, bei der bislang vier Kurz- und sechs Langfilme entstanden sind, darunter „Wolke Neun“, „Willenbrock“ und „Die Polizistin“. Aber auch für das Fernsehen schreibt die Grimme-Preisträgerin regelmäßig, zuletzt verfasste sie Drehbücher für die Komödie „Eine Braut kommt selten allein“ und für das Drama „Die Opfer – Vergesst mich nicht“ (Mitten in Deutschland: NSU). Das dramaturgische Handwerkszeug erlernte Laila Stieler an der Filmhochschule „KONRAD WOLF“ in Babelsberg. In ihren Drehbüchern bearbeitet sie oft biografische oder literarische Stoffe. Neben dem Schreiben ist die gebürtige Thüringerin (Jahrgang 1965) zeitweise auch als Produzentin tätig ist. Heute lebt sie im Boitzenburger Land.
Frau Stieler, was verbinden Sie persönlich mit dem Liedermacher Gerhard Gundermann? Er hat sie ja einige Jahre lang sehr intensiv begleitet.
Ich war nur auf einigen seiner Konzerte und kannte ihn auch nicht persönlich, aber ein Freund aus meiner Jugendzeit spielt in der „Seilschaft“ und brachte mir vor vielen Jahren mal eine CD vorbei. Die bildhafte Sprache und Melancholie der Texte ließ in mir gleich die Assoziation entstehen: ‚Das ist ja ein Film.‘ Auch fühle ich mich mit gewissen Dingen aus Gundermanns Biografie verwandt. Seine Widersprüchlichkeit, dieses gleichzeitige Dafür- und Dagegensein war in meiner Wahrnehmung typisch für viele DDR-Bürger. Nicht zuletzt hat für mich dieser Extrem-Idealist auch etwas von einem Narren. Solche naiven Helden sind immer interessant und Gundermann macht es einem nicht leicht, ihn zu beurteilen.
Welche speziellen Herausforderungen bringt die filmische Umsetzung eines solch speziellen Lebensweges mit sich?
Nun, ganz allgemein richtet sich das Leben nicht nach der Dramaturgie. Im Gegenteil: Gerhard Gundermann als meine Hauptfigur schien sich dagegen zu sträuben, in ein Konzept gepresst zu werden. Es hat also eine Weile gedauert, bis ich die für seine Biografie angemessene Form fand. Und dann musste ich die Balance finden zwischen dem Realen und dem Erfundenen, also zwischen den unverrückbaren Daten und den Räumen für meine Fantasie. Außerdem gab es eine Unmenge Material und viele Zeitgenossen mit ihrer jeweils eigenen Sicht auf den Liedermacher. Von diesem Erwartungsdruck habe ich mich im Laufe des Schreibprozesses befreit. So stand von Anfang an für mich fest, dass ich diese Geschichte auf keinen Fall linear erzählen wollte.
Der Film ist zwar thematisch ein Rückblick – gleichzeitig setzt er heute viele Gedanken und Diskussionen frei. War das ein Ziel beim Schreiben?
Nicht explizit, aber natürlich hoffen wir, dass unser Film Diskussionen anregt. Bei
„Gundermann“ habe ich mich gefragt: Wie lebt jemand mit einer solchen Zerrissenheit und
wie bringe ich sie Menschen nah, die das so nicht erlebt haben?
Worin wurzelt Ihre Zusammenarbeit mit Andreas Dresen?
Wir arbeiten zusammen, seit wir uns kennen, also seit dem 1. Studienjahr. Mir gefiel von Anfang an, wie liebevoll und präzise er mit Figuren umgeht, und dass er dabei zugleich einen visionären und provokanten Blick auf Themen und Geschichten hat. Hinzu kommt, dass er ein großzügiger, freundlicher, bescheidener Mensch ist. Aus der jahrelangen Arbeitsbeziehung wurde eine enge und verlässliche Freundschaft. Das funktioniert, weil wir uns gegenseitig respektieren und schätzen. Er hat mich immer spüren lassen, dass er an meine Arbeit, an unsere Geschichten glaubt. Und das ist beim Schreiben, das ja oft sehr einsam und von Zweifeln durchdrungen sein kann, enorm wichtig.
Welches Publikum haben Sie bei der Arbeit vor Augen?
Mich selbst. Ich gucke gern gut gemachte, unterhaltsame Filme. Ich finde immer, dass ein ernsthaftes Thema und eine unterhaltsame Erzählweise kein Widerspruch sind. Und so würde ich auch gern schreiben.
Viele Ihrer Geschichten sind im Osten angesiedelt. Was reizt Sie daran?
Ich bin nicht auf ostspezifische Stoffe festgelegt, aber vielleicht drängen sie sich mehr auf, weil ich selbst eine ostdeutsche Herkunft habe. Es ist durchaus leichter, über etwas zu schreiben, was man kennt.
Sind ostdeutsche Stoffe schwieriger zu finanzieren?
Nun, bei „Gundermann“ haben wir tatsächlich lange um die Finanzierung gekämpft, aber noch länger darum, einen Produzenten zu finden, der uns voll und ganz unterstützt und das Projekt nach vorn bringt. Als Pandora dann als Produzent und Verleih mit ins Boot kam, gab es dann diesen Schub und „Gundermann“ kam ins Rollen. Die höchste Summe für den Film kam am Ende aus Nordrhein-Westfalen.
Zwar wird in Ostdeutschland viel gedreht, aber vergleichsweise wenige Geschichten spiegeln die Lebenswirklichkeit der Menschen hier filmisch wider. Der Osten dient quasi als Kulisse. – Wie empfinden Sie das?
Ich will mir da kein Urteil anmaßen, unsere Wahrnehmung ist natürlich selektiv. Sicher werden die Sonnen- und Schattenseiten des Ostens weniger reflektiert, als wünschenswert wäre, und vor den Differenzierungen kommen erst mal die Stereotype wie Arbeitslosigkeit, leere Häuser oder rechte Gewalt. Insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass es relativ wenige Filme gibt, die meine Erinnerungen an dieses Land widerspiegeln. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sich das jetzt gerade ändert.
Welche ostdeutschen Stoffe würden Sie gern auf der Leinwand sehen?
Da habe ich einen ganz konkreten Wunsch: Ich würde sehr gern Christoph Heins Roman „Landnahme“ umsetzen. Er beschreibt darin über 50 Jahre die Karriere eines aus Schlesien Vertriebenen, der in einer fiktiven, ostdeutschen Kleinstadt zum größten Unternehmer der Region aufsteigt und dafür einen hohen Preis zahlt. Die DDR kommt im Buch nur beiläufig vor, vordergründig geht es um den Mikrokosmos einer Kleinstadt und darunter eben um die Verluste einer erfolgreichen Anpassung.
An welchen Themen sitzen Sie aktuell?
Es gibt immer mehrere Projekte in unterschiedlichen Stadien, die ich parallel bearbeite. Zum einen gibt es da einen Fernsehfilm über das Leben von Hilde Coppi. Sie kämpfte als Mitglied der Roten Kapelle gegen die Nazis und wurde 1943 hingerichtet. Da war ihr Sohn erst ein gutes halbes Jahr alt. Zum anderen arbeite ich mit Andreas Dresen an einem Stoff über die Mutter des ehemaligen Guantanamo-Gefangenen Murat Kurnaz. Und ganz frisch gibt es einen Stoff aus der Uckermark, wo ich selbst lebe, aber der steht noch am Anfang.
Was fasziniert Sie an der Arbeit als Drehbuchautorin?
Es ist sowohl das Eintauchen in spannende Welten und Lebensläufe als auch die Freude am Fabulieren, am Setzen von Pointen und an der Zwiesprache mit den Figuren, die im Laufe des Schreibprozesses ein Eigenleben entwickeln.
Wo liegen die Unterschiede zum Schreiben von herkömmlichen Büchern?
Ich habe ja bisher nur Drehbücher geschrieben und da finde ich die Grenzen des Mediums Film durchaus hilfreich: Also, du erzählst ausschließlich im Präsens und kannst nur das beschreiben, was sichtbar ist. Für innere Prozesse, Gedanken, Stimmungen etc. musst du einen äußeren Vorgang finden. Das ist eine spannende Herausforderung. Hinzu kommt die Begrenztheit durch die Laufzeit des Filmes. Bei Fernsehproduktionen sind die Vorgaben meist deutlich enger als bei Kinofilmen. Bei Büchern fällt das alles weg, aber mich würde die Uferlosigkeit der großen Freiheit wohl eher einschüchtern.
Drehbuchautor*innen sind in Deutschland kaum der Öffentlichkeit bekannt. Wünschen Sie sich mehr Anerkennung?
Mehr mediale Wahrnehmung und Respekt für die Arbeit von Autoren und Autorinnen wäre in der Tat wünschenswert. Meist werden neben dem Regisseur und den Schauspielern allenfalls noch die Kameraleute erwähnt. Mir scheint, in den USA und in Frankreich genießen meine Kollegen eine größere Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite erfahre ich in meiner Arbeit mit Regisseuren in der Regel sehr viel Respekt und Wertschätzung. Wird das Drehbuch geändert, fragen sie mich nach meiner Meinung. Ich kann mich da nicht beschweren.
Vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Dörthe Gromes