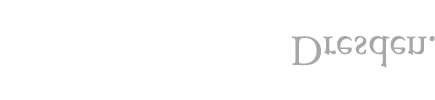Porträt Sebastian Hilger
66. Berlinale 2016 – Der Regisseur Sebastian Hilger steht im Colloseum Kino am Prenzlauer Berg vor Berlinale-Publikum und beantwortet die Frage, was denn für ihn der emotionale Kern seines Diplomfilms „Wir sind die Flut“ sei. Mit trockenem Humor beschreibt er diesen mit einem „Gefühl von Starre, das sich wieder auflöst. Wir sind aus unseren Ausbildungen – Filmausbildung oder was auch immer – rausgekommen mit großen Ambitionen und dann merkt man plötzlich – eigentlich wartet keiner auf einen“.
Abgesehen davon, ob die Auswahlkommission der Berlinale auf den gebürtigen Rheinland-Pfälzer nun gewartet hatte oder nicht: Die Premiere feierte der Genrefilm damals in der Berlinale-Sektion Perspektive Deutsches Kino.
Eine große Auszeichnung für einen Filmemacher, der für mehr Mut im deutschen Kino plädiert, und dem deutschen Film vorwirft, dass er zu „eindimensional“ sei. Hilger selbst wünscht sich mehr Filme, „die in einer Art und Weise das Fantasievolle und das Sinnliche mit dem Realen verbinden“. Die Möglichkeiten des Films, weit mehr als das Reale abzubilden, möchte er gerade in seinem Filmstil auskosten. Und so erzählt er in „Wir sind die Flut“ von zwei jungen Forschungsstudenten, die auf eigene Faust losziehen, um im kleinen Ort Windholm zu untersuchen, wieso vor 15 Jahren das Meer vor dessen Küste verschwand und mit ihm die Kinder der Bewohner. Eine mutige Entscheidung von ihm und Drehbuchautorin Nadine Gottmann in Richtung Mystery und Science-Fiction.
Der Entschluss hierzu hat sich ausgezahlt, denn ein Jahr später, auf der 67. Berlinale, stoße ich dazu, als die Producer von „Wir sind die Flut“ berichten, wie es beim Vertrieb des Films läuft, der immer noch auf Kinotour ist. Edgar Derzian, Johannes Jancke und Lasse Scharpen vertreiben seit dem Kauf der Rechte den Film selbst. „Dazu haben wir uns entschieden, weil wir uns gesagt haben, dass das eigentlich für uns eine große Chance ist, diesen Markt besser zu verstehen: was funktioniert und was funktioniert nicht. Wir wollten das gerne selbst erfahren, weil wir glauben, dass das Wissen darum uns nur helfen kann, den deutschen Film insgesamt dem Publikum auch nahezubringen“, erklärt Hilger.
Bisher lässt sich daraus gut ablesen, dass der Genrefilm auch über die erwartete Zielgruppe hinaus auf Interesse stößt. „Das liegt auch, glaub ich, daran, dass die Leute solche Geschichten mögen und dass es in Deutschland auch zu wenige davon gibt“, schlussfolgert Hilger für sich.
Fast hätte es diesen Film jedoch gar nicht gegeben, denn er war „eine schwierige Geburt“, und hat „in der Entstehungsphase von den Entscheidungsgremien keine große Liebe erfahren“, erinnert sich der Filmemacher.
Doch ohne Durchsetzungsvermögen und Ausdauer geht es nicht bei einem Regisseur wie Hilger, der immer Herausforderungen und Prüfungen sucht, so auch bei seinem ersten Langfilm „Ayuda“, den er selbst als „Riesenalbtraum“ bezeichnet. Eine „Kamikazenummer“, die er während seines Studiums der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Köln – noch vor der Filmakademie Ludwigsburg – realisierte. Circa fünf Jahre lang arbeitete er damals mit Drehbuchautorin Nadine Gottmann und Team an dem Film und hatte mit lediglich zwei oder drei vorangegangenen Kurzfilmen „keine Ahnung von nichts“ – und drehte ihn immerhin gleich auf 16mm. Hilger ist aus dieser Erfahrung selbstkritisch und darin aber auch sehr selbstsicher hervorgegangen: „Es war eine wichtige Erfahrung in Bezug aufs Filmemachen, aber auch auf das Scheitern. Das ist ja eine Situation, der man in unserem Gewerbe ständig ausgesetzt ist. Wenn heute was gelingt, kann es sein, dass es morgen total misslingt.“
Wäre zu dem Zeitpunkt nicht die Zusage der Filmakademie gekommen, hätte sein Leben womöglich eine andere Wendung nehmen können. Die Jahre ab 2011 in Ludwigsburg fühlten sich „wie auf einer Militärakademie“ für ihn an, mit einer wertvollen Umgebung ohne jederlei Ablenkung und stattdessen Input von extrem motivierten Kommilitonen.
Fast wäre Hilger jedoch tatsächlich auf einer Art Militärakademie gelandet, wäre er seinem ursprünglichen Impuls gefolgt und nach dem Abitur Polizist geworden. Wegen eines Filmprojekts kurz vor seinem Abitur änderte sich jedoch alles: „Ich habe gemerkt, zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, dass ich voll bereit war, 16 Stunden, 20 Stunden zu investieren – ohne Probleme.“ Das war mit 18. Ab dem Zeitpunkt begann er, Kurzfilme und Imagefilme zu drehen; zunächst als Freundschaftsdienste. In seinem privaten Umfeld wurde er als „der mit der Kamera“ bekannt. 2006 lief es bereits so gut, dass er die eigene Firma footsteps Filmproduktion in Köln gründete. Mittlerweile ist footsteps mit ihm nach Leipzig gezogen. Eine Stadt, an der ihm vor allem reizt, dass hier eine Filmszene noch am Entstehen ist und nicht schon einfach besteht wie in Berlin oder München. Nicht nur die Kreativszene empfindet er als einladend, sondern schätzt den kurzen Draht zu den Förderern und die realistischeren Chancen auf die Förderung von Projekten.
Wenn die Zeit da ist, produziert er immer noch gerne Auftragsproduktionen. Von diesen hat er als Vorbereitung für seine Spielfilme schon früher viel gelernt. Dank ihnen konnte er nicht nur seinen ersten Langfilm „Ayuda“, sondern auch seine über 15 Kurzfilme selbst finanzieren.
Dafür wird ihm jedoch kaum noch Zeit bleiben, nachdem er erst letzten Sommer ein halbes Jahr lang von Berlin aus an dem Fernsehfilm „Familie ist kein Wunschkonzert“ gemeinsam mit Autorin Nadine Gottmann arbeitete. 2014 hatten beide bereits für ihr gemeinsames Treatment den ARD-Degeto-Stoffentwicklungs-Preis „Impuls“ gewonnen. Dieser ermöglichte ihnen, in den letzten beiden Jahren das Drehbuch zu entwickeln. In der Familienkomödie erzählen sie von drei chaotischen Schwestern mit keinen festen Jobs und keinen festen Beziehungen. Ein Kuckuckskind befindet sich auch darunter. Diese Entdeckung soll auf der Silberhochzeit der Eltern, die tatsächlich auf einem Ponyhof leben, verkündet werden.
Mit seinem ersten Fernsehfilm, mit Elementen des Roadmovies inbegriffen, belegt Sebastian Hilger einmal mehr, dass er das „Filmemachen mehr als Gestaltungsherausforderung wahrzunehmen versucht“. „Filmemachen kann man niemals auslernen“, ist sich Hilger sicher, und das mag stimmen bei einem Filmemacher, der sein Repertoire stets erweitert: von dokumentarischem Arbeiten ohne Script über Musical-Elemente bis hin zu anspruchsvollen Plansequenzen und Genrefilmen. Nun fallen auch Fernsehfilme darunter, für die er nicht nur als Co-Autor tätig ist, sondern bei der Produktion von Real Film auch gleich selbst Regie führt, getreu seines Mottos: „Das sollte dann schon der beste Film werden, den man daraus machen konnte.“
Autorin: Sabine Kues