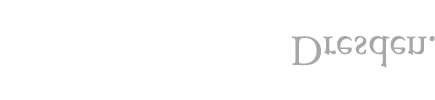Interview mit DOK Leipzig-Kuratorin Franziska Bruckner
Unser aktuelles Heft AUSLÖSER 03/2017 erscheint am 19. September und widmet sich dem Thema „Animation“. Hierzu sprachen wir mit der Animationsfilmwissenschaftlerin und diesjährigen Gast-Kuratorin bei DOK Leipzig, Franziska Bruckner, über ihr Sonderprogramm „Nach der Angst“.
„Nach der Angst“ ist nicht nur das Motto vom 60. DOK Leipzig sondern auch das Thema Ihres Sonderprogramms für Animationsfilm. Was können wir unter diesem Titel erwarten?
Ich habe mich zunächst gefragt: welche Möglichkeiten gibt es, um mit Angst umzugehen? Daraufhin habe ich mich für vier Schwerpunkte entschieden. Das sind Themen und Filme, mit denen man unterschiedliche Aspekte der Angst abdecken kann. Da Animation ein stilistisch heterogenes Medium ist, war es mir einerseits wichtig, verschiedene Animationstechniken abzudecken: wie Stop-Motion, Zeichentrick, 3D-Computeranimation – teilweise in Kombination mit Realfilm – andererseits unterschiedliche Genres – sei es im fiktionalen, dokumentarischen Bereich oder dazwischen. Mein Überthema ist F-E-A-R und der erste Schwerpunkt heißt „Fear for Fun“, da vor allem im Zeichentrickfilm oftmals sehr lustvoll mit Angst umgegangen wird. Ein Film, der sehr bekannt ist, ist z.B. „Vormittagsspuck“ von dem Experimentalfilmemacher Hans Richter. 1928 hat er damit einen Stop Motion-Live Action-Hybrid erstellt, wo Gegenstände zum Leben erwachen und die Protagonisten ärgern. Der zweite Schwerpunkt lautet „Eerie Evolutions“ und der Ausgangspunkt ist: Welche Zukunftsängste haben wir und wie können wir mit ihnen umgehen? Darin geht es um unterschiedliche Zukunftsperspektiven bis hin zu Weltuntergängen als skurrile Szenarien. Das Ende der Welt ist z.B. nicht weiter schlimm, wenn es – aus der Perspektive von zwei Steinen gesehen – nur einen Wimpernschlag dauert. Die Animation hat eben diese Möglichkeit, schreckliche Themen ernsthaft zu verhandeln, aber auch mit einem kleinen Augenzwinkern.
Und welche Facetten der Angst verbergen sich hinter den anderen beiden Programmpunkten?
Der dritte Schwerpunkt „Adapting to Angst“ beinhaltet, wie man mit Angst umgeht, z.B. in dem bekannten Film „Madame Tutli Putli“ von 2007. In dem Stop-Motion Film wird die Protagonistin mit den Geistern ihrer Vergangenheit konfrontiert. Hier wird die Überwindung von Angst gezeigt. Im gleichen Programm stellt sich aber auch die Frage: Wie lebt man mit Angst? In „Life Cycles“ von Ross Hogg, sieht man mediale Kriegsberichterstattungen parallel zum Alltag. Die Angst läuft so mit; vor allem getragen durch die Medien. Aber das Leben geht trotzdem weiter. Das letzte Programm heißt „Raw Revelations“, da habe ich dann doch noch ein Horrorfilmprogramm kuratiert. Einerseits soll man sich ein bißchen gruseln, andererseits sollen ernste Themen angesprochen werden, die durchaus verstören und wo dann die Angst gleichzeitig mit dem Programm zu Ende ist.
Der Titel lautet „Nach der Angst“. Sind die Filme ein Hilfsmittel zur Überwindung von Angst oder ist es eine Zustandsbeschreibung?
Dieses „Nach der Angst“ ist natürlich schwierig, weil dieses Nach so beliebig sein kann. Man könnte sich entscheiden, nur Filme zu zeigen, die aufbauend sind – und vielleicht auch etwas eskapistisch – mir war aber wichtig, dieses Angst-Thema nochmals einzubringen. Es ist vielleicht eine Metaebene von Angst. Beim ersten Programm ist es wirklich diese Leichtigkeit: ich habe keine Angst vor der Angst bzw. Angst ist lustvoll und beim zweiten Programm sind es schreckliche Szenarien und ich fürchte mich trotzdem nicht, und ironisiere vielleicht. Es sind keine bedrückenden Filme. Bei dem dritten Programm geht es mir darum Ansätze zu zeigen, um mit Angst umzugehen. Es gibt Ängste und ich kann sie überwinden. Bei dem Programm hoffe ich, dass die Leute danach rausgehen und sagen: „Ich habe etwas mitgenommen.“ Der Umgang mit Angst spielt schließlich auch im Alltag immer eine Rolle kann auch etwas Positives haben. Sie kann z.B. als Warnfunktion dienen oder den Beginn eines Lösungsansatzes bieten.
Ist Animationsfilm als Darstellungsform für dieses Thema prädestiniert?
Auf jeden Fall – zumindest in dieser heterogenen Form. Da Animation oftmals immer noch mit Kinderfilm assoziiert wird, war es mir einerseits wichtig, die Bandbreite des Animationsfilms darzustellen und dass es auch Animationen gibt, die Furcht erzeugen. Andererseits wollte ich natürlich auch Möglichkeitsformen austesten. Dafür ist Animation wirklich prädestiniert, weil man alles damit machen kann: ob realistische Gegenwartsdarstellungen oder surrealistische Zukunftsvisionen.
Sie forschen und lehren zum deutschsprachigen Animationsfilm. Gibt es hier einen Trend, den Sie derzeit besonders spannend finden?
Ich habe bisher vor allem zur Geschichte der österreichischen Animation und über ost- und westdeutsche Animationsfilme der 1960er geforscht. An der aktuellen Animationsfilmlandschaft in Deutschland ist mir – wie auch in anderen Ländern – aufgefallen, dass die Produktion seit der Digitalisierung explodiert ist. Es wird insgesamt mehr Animation produziert und die Hochschulen sind stärker in der Animation präsent – sei es in Ludwigsburg, Köln oder Potsdam. Auffällig dabei ist die technische und stilistische Heterogenität. Wenn man Studierendenfilme anschaut, sieht man viel digitale Animation im 2D und 3D Bereich, aber gleichzeitig kommt ein Revival der digital unterstützten Stop-Motion. Insgesamt wird die Animationsfilmproduktion also immer mehr – vor allem die Kurzfilmproduktionen an Hochschulen.
Ist es gerade eine gute Zeit für den Animationsfilm?
Ja, es ist insofern eine gute Zeit, weil es nicht nur einfacher und kostengünstiger ist Animation zu produzieren, sondern auch zu präsentieren. Animationen auf Online-Plattformen wie Youtube und Vimeo sind geradezu explodiert, muss ich sagen, und auch die Animationsfilmfestivals haben an Bedeutung gewonnen. Aktuell gibt es weltweit so viele Animationsfestivals, wie nie zuvor und fast jedes Kurzfilmfestival hat mittlerweile eine Animationsfilmschiene, was ich sehr erfreulich finde. Bei DOK Leipzig ist es noch mal spezieller, weil hier das Dokumentarische im Fokus liegt. In diesem Bereich ist es spannend, dass die animierte Dokumentarfilm-Produktion in den letzten zehn Jahren generell gestiegen ist. Das merkt man auch in der Forschung, weil viele über Animadok arbeiten. Animierte Dokumentarfilme gibt es zwar bereits seit Beginn der Filmgeschichte, aber sie wurden selten als solche rezipiert. Durch diesen neuen Animadok-Blickwinkel wird einerseits der Dokumentarfilm geöffnet, indem man sagt, man braucht nicht unbedingt realfilmisches Material, um dokumentarische Formen auszufüllen und andererseits sind mehr Filme mit der Genre-Bezeichnung animierter Dokumentarfilm entstanden. Es ist gleichzeitig das Bewusstsein gestiegen und auch die Animadok-Produktion.

Welchen internationalen Stellenwert nimmt DOK Leipzig für Sie ein?
Bei DOK Leipzig ist die Kombination von Dokumentar- und Animationsfilm spannend. Es ist vielleicht nicht das wichtigste Animationsfilmfestival – da gibt es ältere und größere mit einem speziellen Animationsfokus –, aber DOK Leipzig macht eben dieses Scharnier zwischen Dokumentation und Animation aus. Das ist etwas, das hier sehr gut angesprochen und gefördert wird. In den letzten Jahren wurde der Animationsfilm auch noch mal stärker in die Wettbewerbsprogramme integriert. Ich freue mich natürlich, wenn der Animationsfilm bei DOK Leipzig gut vertreten ist, vor allem, weil hier ein anderes Publikum verkehrt. Bei klassischen Animationsfilmfestivals ist es so, dass oftmals bereits „Bekehrte“ die Programme besuchen und bei DOK Leipzig kann man neue Leute für Animation begeistern.
Sie forschen selbst viel zu hybriden Formen und dem Animationsfilm allgemein. Wie hat sich das Forschungsfeld entwickelt?
Wenn man Animationsfilmforschung weltweit betrachtet, hat sich diese seit den 1980er Jahren enorm entwickelt. Im angloamerikanischen Raum gibt es seit dieser Zeit die Society for Animation Studies und auch in Deutschland findet man einige Vorreiter, z.B. Uli Wegenast, der Leiter des ITFS in Stuttgart, der aus der Kunstwissenschaft kommt.
In der deutschsprachigen Forschung hat in den letzten Jahren eine junge Generation erkannt: Da gibt es ein Desiderat! Dadurch haben wir auch bessere Möglichkeiten uns zu vernetzen. Die AG Animation dient z.B. dazu Animationsforschung voranzutreiben. An der Universität in Tübingen gibt es aktuell ein Zentrum für Animationsforschung, wo ich immer wieder zugegen bin. Und in meiner neuen Funktion an der Fachhochschule St. Pölten wird dieser Schwerpunkt auch eine Rolle spielen. Noch ist es manchmal so, dass man als JungforscherIn an einem universitären Standort ein Alleinstellungsmerkmal hat, aber durch die nationale und internationale Vernetzung unterstützen wir uns sowohl gegenseitig, als auch jegliche Form von Animation, die auf Festivals oder anderen Plattformen präsentiert wird.
Dr. Franziska Bruckner ist Animationsfilmwissenschaftlerin und Leiterin der Forschungsgruppe Media Creation an der Fachhochschule St. Pölten. Sie studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien sowie Malerei und Animationsfilm an der Universität für angewandte Kunst Wien. Für das 60. DOK Leipzig kuratiert sie das Sonderprogramm Animationsfilm „Nach der Angst“.
60. DOK Leipzig Sonderprogramm Animationsfilm
Interview: Sabine Kues