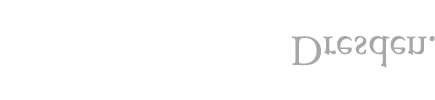Wie DOK Neuland mit Extended Reality die Grenzen des dokumentarischen Erzählens verschiebt.
Ein weißes Domzelt auf dem Marktplatz erregte im Oktober 2015 während des Leipziger Dokumentar- und Animationsfilmfestivals die Aufmerksamkeit der Passant:innen. Als interaktive Ausstellung bietet DOK Neuland Künstler:innen eine Plattform für ihre Perspektiven des dokumentarischen Erzählens und deren multimediale Umsetzung. Im Debütjahr der Ausstellung standen Webdokumentationen im Mittelpunkt. Denn zu diesem Zeitpunkt galten immersive Erlebnisse durch Extended Reality (XR) noch als Seltenheit. Durch die technologische Weiterentwicklung hat DOK Neuland sein Angebot erweitert und ist seither bestrebt, die Grenzen des dokumentarischen Erzählens zu verschieben. Heute füllen überwiegend VR-Installationen und 360-Grad-Filme die Räumlichkeiten von DOK Neuland. Damit hat die Technologie weitgehend ihren Prototypen-Status verlassen und ermöglicht es Künstler:innen, diese wesentlich unkomplizierter und direkter einzusetzen.
Vom Domzelt ins Museum
Der Maler und ehemalige Filmemacher Lars Rummel lernte das interaktive Ausstellungsformat des Leipziger DOK Festivals im Debütjahr 2015 kennen. Seit 2017 begleitet er das Projekt als Kurator. Rund 70 Quadratmeter und bis zu sieben Computer standen im Domzelt zur Verfügung, damit sich Besucher:innen spielerisch und interaktiv mit den Inhalten der Webdokus auseinandersetzen können. Doch schnell wurden auch die Beschränkungen ihrer Interaktionsmöglichkeiten erkennbar.
Die Entwicklung der Virtual- und Augmented-Reality-Technologien ermöglichte es DOK Neuland, neue Darstellungsformen zu erproben. Gleichzeitig erforderten die XR-Arbeiten mehr Ausstellungsfläche, da die Betrachtungsposition durch die technischen Komponenten stark eingeschränkt gewesen sind. Mit dem Leipziger Museum der bildenden Künste fanden die Organisator:innen schließlich einen neuen Ausstellungsraum – obwohl sie anfangs skeptisch waren.
»Wir haben in erster Linie nach leeren Ladenflächen in der Innenstadt gesucht, um eine Sichtbarkeit im Alltag der Menschen, zum Beispiel beim Einkaufsbummel, zu erzeugen. Standorte wie der Messehof oder eine zweistöckige Ladenfläche in der Nikolaistraße entsprachen zwar unseren Vorstellungen, erfüllten jedoch nicht die Bedingungen an unsere Infrastruktur. Als die Einladung vom Museum folgte, war ich aufgrund des elitären und exklusiven Charakters zunächst sehr skeptisch. Heute freue ich mich sehr über die intensive Auseinandersetzung der Besucher:innen mit den Inhalten unserer Ausstellung – auch wenn wir durch den Standort weniger das gewünschte Durchlaufpublikum erreichen.«
»Ein exklusives technisches Medium wie XR wirft viele ethische Fragen auf.«
Mit der Einführung dokumentarischer VR-Installationen und 360-Grad-Filme vollzog sich auch ein Wandel in der kuratorischen Praxis von Lars Rummel und seinem Team. Bedingt durch die Vielfalt und Intensität der durch Extended-Reality verursachten Körpererfahrungen ergaben sich neue Anforderungen bei der Auswahl der eingereichten Arbeiten. Und damit auch an die Rolle des Kurators Lars Rummel.
»Es gibt viele Faktoren, die beeinflussen, welche Arbeiten wir für die Ausstellung auswählen. Der Grad der Interaktivität spielt dabei keine wesentliche Rolle. Viel wichtiger ist das Thema der Arbeit, die Kohärenz der Geschichten sowie die Haltung des Avatars. Als Kurator trage ich die Verantwortung für die Ausstellung und die ausgestellten Werke. Ich muss die von den Künstler:innen vermittelte Haltung in gewisser Weise mittragen und vertreten können. Ein exklusives technisches Medium wie XR wirft viele ethische Fragen auf.«
Eine Einreichung beispielsweise beschäftige sich 2022 mit den Entführungen, Misshandlungen und der Folter von Mitgliedern der Faun-Gong-Gemeinschaft in China durch das kommunistische Regime. Eine Simulation ließ die Nutzer:innen dieses verstörende Ereignis durch einen Körperanzug hautnah miterleben. Für Lars als Kurator eine klare Grenzüberschreitung. Die Verwendung von XR als Medium für körperliche Erfahrungen setzt eine intensive Auseinandersetzung mit ethischen Fragen voraus. Anders als Kinofilme können sie deutlich stärkere Gefühle hervorrufen, indem sie mehr Körpersinne und die uneingeschränkte Aufmerksamkeit des Nutzers oder der Nutzerin adressieren. Außerdem ist die Sensibilität von Mensch zu Mensch verschieden. Die Art und Weise, wie ein Mensch der Erzählform folgt, ist von seinen Ressourcen, seinem Erfahrungshorizont und seiner Achtsamkeit geprägt.
Lars Rummel muss dafür Sorge tragen, dass die Erfahrung für die Nutzer:innen nicht schädlich ist, insbesondere, wenn es sich um intensive, traumatische oder diskriminierende Inhalte handelt. Der Kurator legt viel Wert darauf, dass diese ethischen Fragen angemessen behandelt werden.
Das Konzept der Zwiebelimmersion
Für die Präsentation von VR-Inhalten gibt es noch keine etablierte Kulturtechnik – im Gegensatz zu erprobten Filmdarstellungen im Kino. Dieses Anfangsstadium bereitet eine große Spielfläche für Experimente mit neuen Erzählformen und Perspektiven des dokumentarischen Erzählens, auf der sich Lars Rummel leidenschaftlich austobt. Die physische Visualisierung der künstlerischen Arbeiten und die Materialisierung der Ausstellungsflächen sind daher ein wesentlicher Bestandteil seiner Arbeit. Bei diesem Ausstellungsdesign arbeitet DOK Neuland eng mit den XR-Künstler:innen zusammen.
»VR als Körpermedium bedeutet, dass es vor allem ums Fühlen und den Zugang und das Erleben durch den Körper geht. Doch viele Menschen haben aufgrund ihres digitalen Alltags und ihrer Privilegien Schwierigkeiten, sich überhaupt zu fühlen und den Körper zu benutzen. Um in die digitalen Räume gehen zu können, braucht es daher einen Raum, der angenehm, herausfordernd, aktivierend oder beruhigend gestaltet ist. Es geht darum, so viele Schichten wie möglich sichtbar zu machen und einzufügen, damit man von der Intention, die Ausstellung zu besuchen, bis hin zur eigentlichen Erfahrung durch den Körper die Geschichte erfahren kann.«
Durch das Konzept der »Zwiebelimmersion«, wie Lars Rummel es nennt, schafft DOK Neuland eine tiefgehende Erfahrung für die Besucher:innen. Durch die individuelle Gestaltung der Räume und Installationen wird eine kohärente, aber dennoch individualisierte Umgebung geschaffen. Indem die interaktiven Arbeiten einen physischen Rahmen erhalten, führt DOK Neuland die Teilnehmer:innen an die Arbeiten heran und lässt trotz Abstraktion und Virtualität der Medien einen konkreten Raum entstehen. Extended Reality bietet als technisches Medium völlig neue Möglichkeiten, komplexe Geschichten aufzubereiten und zu erzählen.
Doch was das Leipziger Dokumentar- und Filmfestival mit DOK Neuland wirklich einzigartig macht, ist der Gestaltungswille und das Verantwortungsbewusstsein, komplexe ethische Herausforderungen zu integrieren und eine immersive, körperliche Erfahrung mittels VR zu ermöglichen. Als Pionierformat etabliert DOK Neuland eine neue Kulturtechnik, die die Präsentation von künstlerischen VR-Arbeiten auf eine ganz neue Ebene hebt und einen Besuch der Ausstellung zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Eine bahnbrechende Entwicklung, die ganz sicher nicht in einem gewöhnlichen weißen Domzelt stattfinden kann.
Text: Daniel Korenev | © Susann Jehnichen und DOK Leipzig