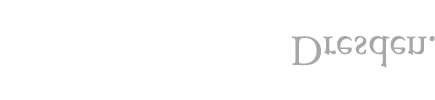Green Storytelling ist nicht gleichzusetzen mit didaktischer Belehrung
April 2020 in Leipzig: Die Rücknahme der Corona-Ausgangsbeschränkungen brachte ein Comeback für umweltschädliche Gewohnheiten. Mit den Menschen kehrte der Alltagsmüll zurück in die Öffentlichkeit. Dabei zeigten noch bis zum Vortag Berichte in sozialen Medien und Zeitungen, wie die Natur sich angesichts fehlenden Verkehrs und menschenleerer Straße »urbane Lebensräume« zurückeroberte. Auch in sächsischen Städten wurden Füchse und andere Wildtiere gesichtet und mehr Singvögel gehört – Nebenwirkung des Lockdown und Utopie vor der eigenen Haustür.
Was hat das bitte mit Storytelling zu tun? Haltungen und Gewohnheiten, die der Kreativen, aber auch die von erdachten Charakteren, spielen beim Erschaffen fiktionaler Geschichten eine zentrale Rolle. Bringt man als Autorin nachhaltige Ideen in die Stoffentwicklung ein, folgen jedoch sehr oft Grundsatzdiskussionen. Abweichungen zum durchschnittlichen, heteronormativen Verhalten müssen unweigerlich an den Plot gekoppelt sein, so die Forderung. Wenn Figuren in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Ernährung, soziales Engagement oder Diversität »Besonderheiten« aufweisen, dann sollen sich diese auch zwingend aus der Geschichte ergeben. Beliebte Beispiele: Vegetarische (oder gar, Himmel hilf, vegane) Ernährung wird Jugendlichen als Werkzeug der Rebellion untergejubelt oder ist eine Metapher für die Abkehr von sozialen Normen. Fahrräder halten für eine sportliche oder hippe, urbane Lebensweise her. Vertreten und leben Protagonisten eines Filmes oder einer Serie eine klare Haltung zum Umweltschutz, dann wird die explizit zum Thema in Dialog und Handlung – aber bitte keine beiläufige Nachhaltigkeit!
Unter dieser vermeintlich sachlichen Herangehensweise steckt der tief verwurzelte Glaube an eine Norm, an simple Mechanismen von »richtig und falsch«. Ein simpler inhaltlicher Vorschlag kratzt bei manchen Branchen-Akteuren an das Wertesystem und zieht Streit nach sich. Dann geht es nicht mehr um das Werk, sondern um die Verteidigung eigener Lebenskomforts. Fördertöpfe und Finanzierungsmodelle stehen dabei gar nicht im Vordergrund, sondern der (politische) Wille der Beteiligten. Erfolgreiche grüne Gegenbeispiele wie der Münsteraner »Tatort« werden zur Ausnahme deklariert, und der Leitspruch »Alles muss eine Bedeutung haben.« gerät zur gleichmachenden Axt. Bleiben also nur didaktische »Themenfilme«? Aber niemand wird gern belehrt. Der mahnende »erhobene Zeigefinger« bringt selten die gewünschten Ergebnisse. Wie sonst kann man also nachhaltige Elemente in eine Handlung einbinden? Ein Schlüssel könnte tatsächlich der Aspekt der Durchdringung sein.
Gerade junges Publikum, das zeigt die Studie »Die Aneignung konvergenter Medienwelten durch Jugendliche« der SLM, sucht in Medien – auch in der Fiktion – nach Vorbildern und bindet sie in eigene Narrative ein. Die Freude an Erfolgserlebnissen oder Erkenntnissen (z.B. »Life Hacks«) zeigen durch diese Multiplikation eine enorme Wirkung. Gut verdeutlichen lässt sich dies ironischerweise an Negativ-Exempeln, z.B. einem wiederkehrenden, trivialen Motiv – der Zahnputz-Szene. Sie kommt oft zum Einsatz, um Tagesroutinen zu zeigen oder, wenn mehrere Personen gemeinsam der Zahnpflege nachgehen, Nähe und Vertrautheit. Und viel zu oft läuft dabei unentwegt das Wasser im strammen Strahl aus der Leitung. Hand aufs Herz, wie oft im Alltag haben wir den verschwenderisch offenen Wasserhahn gesehen oder gar selbst verursacht? Das Motiv umgibt uns, ist durch Wiederholung gut geübt und durchdringt unsere Vorstellung, wie die Routine des Zähneputzens auszusehen hat. Weitere Symptome des rücksichtslosen Konsums durchwirken als vermeintliche Accessoires eines vollwertigen Lebens unsere Erzählwelten: Schnelle Autos und Flugreisen, Fast Food und Fleischkonsum, der Kaffee auf die Hand – anders ist ja nicht cool – oder »Kleidungs-Shopping-Szenen« als Ausdruck von Lebensfreude, die aber eigentlich »Fast Fashion« propagieren. Hinterfragt man diese in der Stoffentwicklung, wird man gern abserviert, denn »das Publikum weiß sehr wohl zwischen Realität und Wirklichkeit zu unterscheiden«.
Ein kurzer Ausflug ins Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften: Dort wurde in einer Studie im Mai 2019 eindrucksvoll die Kraft der Vorstellung verdeutlicht. Was wir uns bildlich vorstellen können, das beeinflusst nachweislich unsere Haltungen und Entscheidungen. Und sind Filme nicht immer Inspiration und Anstoß, um mit schierer Phantasie Situationen und Welten zu erkunden? Ein weiteres Phänomen animierte die Wissenschaftler des Leipziger MPI zur weiteren Forschung – die Fähigkeit des Menschen, aus dem »Vorgestellten« genauso zu lernen wie aus tatsächlich Erlebtem. Wir glauben also, was wir sehen, auch die Utopie vor der Haustür. Was Zuschauer:innen in ihre Vorstellungswelten aufnehmen, beeinflusst ihr Verhalten im Alltag. Darin könnte die eigentliche Kraft des Green Storytelling liegen.
Populär erzählte Filme und Serien können Details transportieren, die für bewussten Konsum stehen. Autor:innen durchdringen auf diese Art wirkungsvoll die Erlebniswelt des Publikums mit Geschichten, in denen nachhaltiges Verhalten selbstverständlich ist und keinerlei Plot-Rechtfertigung braucht. Und wenn wir schon dabei sind, wird das Thema »gesellschaftliche Nachhaltigkeit« gleich integriert – mit gelebter Diversität und Rücksicht.
Roman Klink
ist Leipziger Film- und Serienenthusiast, Autor, Dramaturg, Stoffentwickler, Filmscout, Lektor sowie gelegentlicher Filmjournalist.